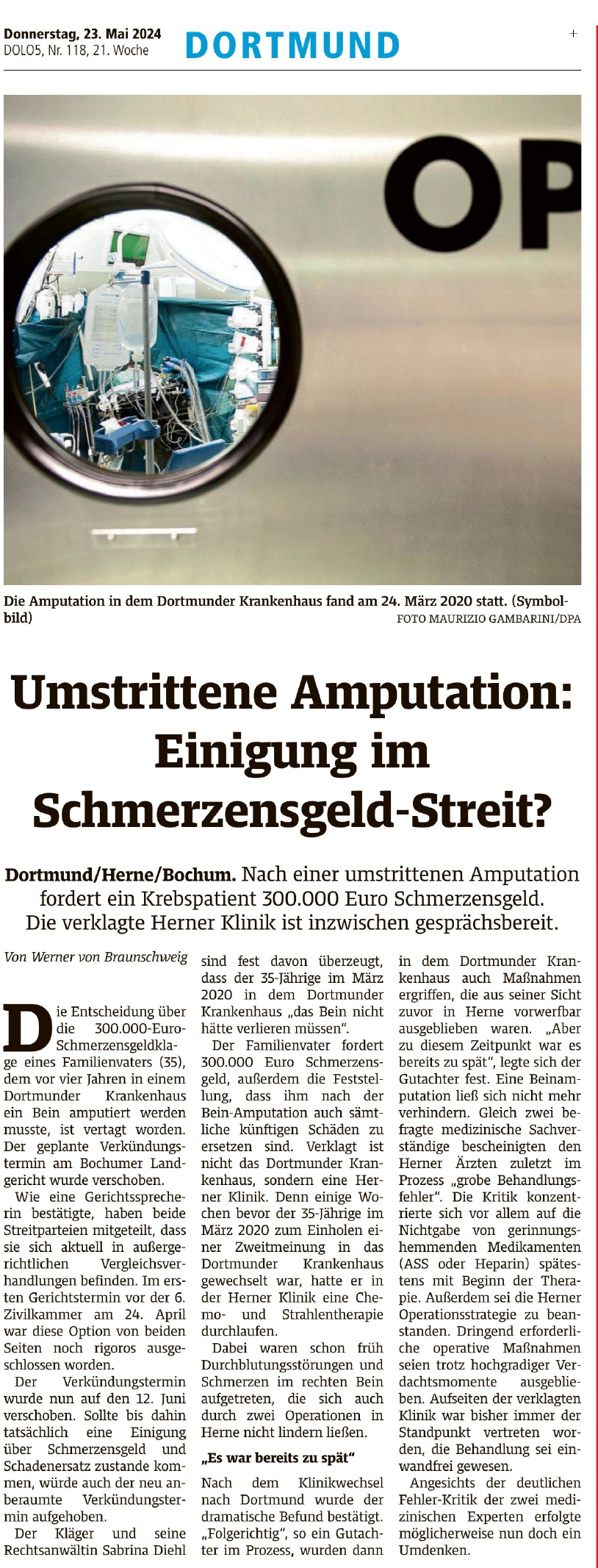"Recklinghäuser Zeitung" 11/12/2024 - Artikel von Tina Brambrink - Tod durch Behandlungsfehler? Witwe von Jürgen Klahs kämpft um ihr Recht
- Presse
- Printmedien
Quelle: "Recklinghäuser Zeitung" 11.12.24 - Tina Brambrink
Tod durch Behandlungsfehler? Witwe von Jürgen Klahs kämpft um ihr Recht
Recklinghausen. Der beliebte Fußballtrainer starb 2020 an einem Herzinfarkt. Zwei Tage vorher hatte er im Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen in der Notaufnahme Hilfe gesucht.
Sein überraschender Tod am 17. August 2020 hat auch viele Fußballfans in der Region sehr berührt. Jürgen Klahs war ein engagierter Fußballverrückter, als Spieler und als Trainer - geerdet, geradeheraus, emotional. Er stand für diverse Vereine, in Recklinghausen und in der Region, an der Seitenlinie. Der durchtrainierte Mann schien fit wie ein Turnschuh, joggte regelmäßig, fuhr Rad, kickte gerne noch mit. „Plötzlich klagte er nach einer Joggingrunde über starke Schmerzen in der linken Brust und Kurzatmigkeit bei Belastung", erinnert sich seine Frau Silvia. Am Samstag, 15. August 2020, fuhr sie deshalb mit ihm zum Knappschaftskrankenhaus in Recklinghausen.
Jürgen "Klahsi" Klahs war ein leidenschaftlicher Fußballtrainer. 2020 ist er im Alter von 64 Jahren gestorben. Seine Witwe Silvia Klahs ist überzeugt, dass er noch leben könnte.
"Mein Mann wurde mitten aus dem Leben gerissen..."
Zwei Tage später fand die 64-Tährige ihren Mann morgens tot in seinem Bett. „Er war schon kalt", sagt Silvia Klahs. Sie kämpft mit Tränen. Auch mehr als vier Jahre später lassen die Erinnerungen sie schlecht schlafen. Aber vor allem eines macht ihr zu schaffen: „Mein Mann könnte noch leben, wenn die Arzte im Krankenhaus sich richtig um ihn gekümmert hätten." Denn was zunächst nur eine Vermutung war, wurde kurze Zeit später bestätigt. Um Gewissheit zu haben, ließen die Witwe und ihre beiden erwachsenen Söhne ihren verstorbenen Ehemann und Vater obduzieren. Und das erschütternde Ergebnis bestärkte die Witwe, weiter nachzuforschen.
Kein EKG und kein Labortest
Aber der Reihe nach: An besagtem Samstag im August 2020 wurde der bekannte Fußballtrainer zunächst von einer Ärztin in der allgemeinen Notfallpraxis am Knappschaftskrankenhaus untersucht. Trotz Nachfrage machte sie kein EKG und leitete ihn ohne den Hinweis auf mögliche kardiale Ursachen weiter zur Notfallambulanz des Knapp-schaftskrankenhauses. Auch dort wurden nach seinem Bericht von einem lange zurückliegenden Fahrradsturz nur Röntgenaufnahmen der Rippen gemacht. Für EKG und Troponin-Test sah der diensthabende (damalige) Assistenzarzt jedoch ebenfalls keine Notwendigkeit. Der Hausarzt könne zu einem späteren Zeitpunkt ein EKG machen, hieß es. Dann wurde Jürgen Klahs nach Hause geschickt. Zwei Tage später starb er - laut Obduktionsbericht an den Folgen eines Herzinfarktes. „Mein Mann wurde mitten aus dem Leben gerissen. Und das hätte nicht sein müssen. Meine Kinder und ich leiden nicht nur an dem Verlust, sondern auch an der Hilflosigkeit", betont Silvia Klahs. Die beiden waren 32 Jahre verheiratet. Während sie bis 2023 als Lehrerin an einer Realschule in Gelsenkirchen arbeitete, genoss der Spitzname des Verstorbenen, als ehemaliger Vermesser auf der Zeche Blumenthal in Recklinghausen seinen Ruhestand und sein Leben als Vollblut-Fußballtrainer. Ihren beiden Söhnen habe der plötzliche Tod des Vaters den Boden unter den Füßen weggezogen. "Deshalb habe ich mich auch entschieden, die Ungerechtigkeit und Oberflächlichkeit nicht einfach hinzunehmen und Anfang 2021 ein Gutachten bei det Ärztekammer Westfalen-Lippe in Auftrag gegeben." Nach einer zermürbenden Zeit des Wartens lagen schließlich im November 2023 drei Gutachten von drei Sachverständigen vor. Die Fachleute der Gutachterkommission bestätigten einen „gravierenden Befunderhebungsfehler" und "grobe Behandlungsfehler". Der unzureichende Behandlungsauftrag aus der Notfallpraxis entbinde den Arzt in der Notfallambulanz "nicht vom eigenen Nachdenken und Handeln", heißt es außerdem in der Begründung.
Da die medizinischen Experten auch Schadensersatzansprüche für gerechtfertigt hielten, beschloss Silvia Klahs, weiter für ihr Recht zu Auf diese Weise können alle kämpfen und holte sich mit Sabrina Diehl aus Herne eine Fachanwältin für Medizinrecht an die Seite. Für den tragischen Tod von Jürgen Klahs infolge eines Behandlungsfehlers haben sie Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche in Höhe von insgesamt 60.000 Euro geltend gemacht. Während die erstverursachende Ärztin aus der Notfallpraxis inzwischen im Ausland lebe und den Fall zusammen mit ihrer Versicherung aussitze, habe sich die HDI als Klinik-Versicherung im außergerichtlichen Verfahren zunächst kompromissbereit gezeigt, berichtet die Anwältin. Wobei Sabrina Diehl (43) in erster Linie die Klinik in der Haftung sieht. „Der Fehler, den die Ärztin in der Notfallpraxis gemacht hat, hätte nicht zum Tod geführt, wenn der Arzt in der Notfallambulanz vom Knappschaftskrankenhaus die richtigen Sofort-Maßnahmen vorgenommen hätte. Es wäre auch kein, Riesending für eine interdisziplinäre Klinik gewesen, ein EKG und einen Labortest zu machen. Jürgen Klahs wäre operiert worden, hätte Stents bekommen und könnte heute noch leben." Stattdessen sei im Oktober 2024 die endgültige Absage der Regulierung von der HDI gekommen. "Der Skandal für mich ist, dass die Familie trotz bestätigter Fehler beider nicht nur ohne Vater, sondern auch mit dem Wissen dasteht, dass sich beide Beklagte weigern, für ihre Fehler geradezustehen", betont die Rechtsanwältin.
Klinik will gerichtliche Klärung
Auf Nachfrage bestätigt das Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen die Ablehnung der außergerichtlichen Einigung. „Die Klinikum Vest GmbH folgt in solchen Fällen grundsätzlich der Empfehlung ihres Versicherers. Dies entspricht der üblichen Vor-gehensweise, um eine faire und transparente Lösung im Sinne aller Beteiligten zu finden. Gerade bei komplexen Sachverhalten stellt die gerichtliche Klärung für beide Parteien den sachgerechten und angemessenen Weg dar. Auf diese Weise können alle Aspekte umfassend geprüft und geklärt werden", so Klinik-Sprecher Harald Gerhäußer.
Bis zuletzt hatte Silvia Klahs auf ein Einlenken gehofft. „Die Empathielosigkeit der Entscheidungsträger im Knappschaftskrankenhaus macht mich fassungslos. Unsere Trauerbewältigung wird durch das zermürbende Gerichtsverfahren nur noch weiter in die Länge gezogen." Aufgeben will die 64-Jährige trotzdem nicht. Ihren Kampf für Gerechtigkeit setzt sie jetzt mit einer Klage gegen Knappschaftskrankenhaus fort. „Zu Fehlern muss man stehen und dafür auch haften. Wenn alle schweigen, ändert sich nichts. Man muss doch als Patient ernst genommen werden. Ich möchte nicht, dass anderen auch so etwas passiert."